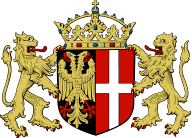Baudenkmäler
Denkmalschutz in Neuss
Warum Denkmalschutz und wo liegen die Anfänge des Denkmalschutzes?
Allgemein wird Denkmalschutz heute verstanden als gesellschaftliches Anliegen, bedeutende Zeugnisse der Geschichte möglichst unverfälscht zu erhalten. Damit soll es den Menschen von heute, aber auch späteren Generationen, möglich sein, sich ein eigenes Urteil über die Vergangenheit zu bilden.
Die Anfänge des Denkmalschutzes gehen auf das 19. Jhd. zurück. In Preussen ist die Einführung der Denkmalpflege als staatliche Aufgabe mit dem Namen des Baumeisters Karl Friedrich Schinkel (1781 – 1841) verbunden. Als Beginn staatlicher Denkmalpflege wird gemeinhin das Jahr 1815 genannt. In diesem Jahr verfasste Schinkel sein Gutachten „Grundsätze zur Erhaltung alter Denkmäler und Altertümer unseres Landes“.
1891 verfügte Kaiser Wilhelm II. in allen preußischen Provinzen für die Belange des Denkmalschutzes Kommissionen einzurichten und ordnete ihnen Provinzialkonservatoren bei. Deren Aufgabe bestand in der Erfassung der Denkmäler, Beratungs- und Gutachtertätigkeit. Entscheidungsbefugnis hatten sie nicht. Diese lag bei den Regierungspräsidenten.
Erster Konservator der Rheinprovinz war Paul Clemen (1866 – 1947). 1892 im Alter von 26 Jahren übernahm er das Amt, das er 20 Jahre lang wahrnahm. Sein Band über die Kunstdenkmäler des Kreises Neuss erschien 1895. Berühmt geworden ist seine programmatische Rede, die er 1946 im erst teilweise wiederhergestellten St. Quirinus-Münster in Neuss hielt mit dem Titel „Das Wort, das vor uns steht und leuchtet, heißt Aufbau, Aufbau …“. Der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz und die Stadt Neuss veranstalteten eine Kundgebung über die Frage des Wiederaufbaus. Die Hörerschar kam aus dem ganzen Rheinland. Unter den Rednern war u.a. der Kölner Kardinal Josef Frings. Angesichts der grossen Aufgabe zum Wiederaufbau zerstörter Städte spricht sich Paul Clemen gegen eine rückwärts gerichtete Baumanier aus. Das ist noch heute die Haltung der Denkmalpflege, die bei Neubauten, Ergänzungsbauten oder Anbauten im Denkmalzusammenhang fordert, im Stil unserer Zeit zu gestalten.
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, welch heftige Diskussionen in der frühen Nachkriegszeit über die richtige Art des Wiederaufbaus geführt wurden, über Rekonstruktion, vereinfachten Wiederaufbau oder Neubau im Stil der neuen Zeit.
In der Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs der 1960er Jahre setzten Entwicklungen ein, wo man die Flächensanierung in die historischen Stadtkerne brachte. Ein Beispiel ist die Sanierung des Viertels Neumarkt/Meererhof. Diese Entwicklung führte zu heftiger Kritik und brachte 1971 das Städtebauförderungsgesetz, das eine erhaltende Erneuerung propagierte und förderte. 1976 wurde das Bundesbaugesetz novelliert und der § 39 h eingeführt, der die Gemeinden ermächtigte, Erhaltungsgebiete auszuweisen. Der Rat der Stadt Neuss hat davon Gebrauch gemacht und 1978 die Erhaltungssatzung für das Gründerzeitviertel beschlossen.
Die Besinnung auf die historische Bausubstanz in den 1970er Jahren führte dazu, dass man die Ansätze des ausgehenden 19. Jhd. / und des beginnende 20. Jhd., als in einigen deutschen Staaten Schutzgesetze erlassen wurden, aufgriff und Denkmalschutzgesetze in den Bundesländern erließ. Das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz trat 1980 in Kraft. Es unterscheidet zwischen Denkmalschutz und Denkmalpflege.
Unter Denkmalschutz werden in erster Linie die administrativen Maßnahmen zur Erhaltung der Denkmäler, wie z. B. die Eintragung in die Denkmalliste oder ggfls. notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen, um den Schutz durchzusetzen, verstanden. Denkmalpflege umfasst den Umgang mit dem Denkmal, die Bauunterhaltung, Sanierung, Renovierung und Restaurierung, kurz alle Baumaßnahmen an Denkmälern.
Was ist nun ein Denkmal?
Das Denkmalschutzgesetz definiert den Begriff und versteht Denkmäler als Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Dieses ist dann gegeben, wenn die Objekte „bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse“ sind „und für ihre Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.“ (§ 2,1)
Der Denkmalbegriff des Denkmalschutzes ist nicht identisch mit dem Denkmal im allgemeinen Sprachgebrauch, wo Sachen wie Standbilder, Kriegerdenkmäler oder Plastiken wie der Eierdieb im Stadtgarten gemeint sind.
Entscheidend dafür, ob ein Objekt Denkmal sein kann, ist seine Bedeutung für die menschliche Geschichte und Entwicklung, z.B. für die Siedlungsgeschichte, die Stadterweiterungsgeschichte, die Industriegeschichte, die Technikgeschichte, die Geschichte des Kirchenbaus, die Geschichte des Friedhofswesens usw.
Denkmalobjekte können Einzelbauten, Strassenzüge, geschlossene Baugruppen, Fabriken, Verwaltungsgebäude, Wassertürme, Brücken, Kirchen, Friedhöfe usw. sein.
Eine weitere Voraussetzung für die Denkmaleigenschaft ist, dass für die Erhaltung und Nutzung Gründe vorliegen. Das können künstlerische Gründe sein bei gestalterischen Qualitäten des Objektes oder wissenschaftliche Gründe, wenn das Objekt für die Forschung wichtig ist oder städtebauliche Gründe bei stadtplanerischen oder stadtgestalterischen Überlegungen.
Eine Spezialform des Denkmals ist der Denkmalbereich. In § 2 Abs. 3 des DSchG NW heisst es:
„Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen und zwar auch dann, wenn nicht jede dazugehörige einzelne bauliche Anlage“ für sich ein Denkmal ist. Statt einer Definition des Denkmalbereiches liefert das DSchG eine beispielhafte Aufzählung. „Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlung, Gehöftgruppen, Strassenzüge, bauliche Gesamtanlagen“ sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend ist.“
Voraussetzung beim Denkmalbereich ist wie beim Einzeldenkmal die historische Bedeutung, die durch Gutachten des Denkmalpflegeamtes nachzuweisen ist. Der Denkmalbereich wird als kommunale Satzung vom Rat beschlossen. Ziel ist die Erhaltung historischer Zusammenhänge und der geschichtlichen Gestalt, d.h. die Erhaltung des historisch gewachsenen Erscheinungsbildes. In dem Miteinander überlieferter Bauwerke und in der Beziehung zu ihrer engeren oder weiteren Umgebung, zum Strassenraum, zu Frei- und Grünflächen liegt die geschichtliche Aussage.
Wann ist ein Denkmal geschützt?
Im Normalfall geschieht dies durch Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Neuss.
In besonderen Fällen, wenn z.B. der Abbruchbagger vor einem noch nicht geschützten Objekt steht, kann die sogenannte vorläufige Unterschutzstellung ausgesprochen werden, im Notfall auch mündlich. Die schriftliche Unterschutzstellung muss dann nachgeschoben werden.
Die Denkmalliste der Stadt Neuss ist eine Loseblattsammlung gemäß Denkmallistenverordnung, in der jedem Denkmal ein eigenes Blatt gewidmet ist. Das Denkmallistenblatt enthält u.a. eine Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals und Grunddaten zur Baugeschichte sowie eine Begründung der Denkmaleigenschaft. Mit Siegel und Unterschrift wird die Eintragung in die Denkmalliste vollzogen und das Objekt dadurch den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterworfen. Die Eintragung geschieht im Benehmen mit dem Landschaftsverband Rheinland/ Rheinisches Amt für Denkmalpflege. Grundlage für die Eintragung ist die „Gesamtbeurteilung der Baudenkmäler für das Stadtgebiet Neuss“ des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege vom August 1984, festgestellt in der Sitzung der Denkmälerkommission vom November 1983. Diese Gesamtbeurteilung ist nicht abschließend, sondern unterliegt der Fortschreibung.
Wer ist für den Denkmalschutz zuständig?
Denkmalbehörden sind das zuständige Ministerium als Oberste Denkmalbehörde, der Kreis als Obere (im Falle der kreisangehörigen Stadt Neuss) und die Stadt Neuss als Untere Denkmalbehörde.
Grundsätzlich ist vor Ort die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde zuständig.
In der Stadt Neuss nimmt das Referat für Denkmalschutz die Aufgaben als Untere Denkmalbehörde für den Bereich der Baudenkmäler und beweglichen Denkmäler wahr. Zu allen Entscheidungen ist das Benehmen mit dem Denkmalpflegeamt des Landschaftsverbandes Rheinland herzustellen.
Leiter des Denkmalpflegeamtes ist der Landeskonservator.
Der Landeskonservator steht in der Tradition der preussischen Provinzialkonservatoren. Die Aufgaben des heutigen Landeskonservators sind im Grunde die gleichen wie die des früheren Provinzialkonservators. Auch er hat keine Entscheidungsbefugnis. Diese liegt bei den Unteren Denkmalbehörden.
Deren Aufgaben im Einzelnen ergeben sich aus dem Denkmalschutzgesetz NW:
- Aufstellung und Fortschreibung der Denkmalliste (Unterschutzstellungen von Baudenkmälern und beweglichen Denkmälern in Einzelverfahren)
- Unterschutzstellung von Bereichen durch Denkmalbereichssatzung oder Erhaltungssatzung
- Beratung der Bauherren/Architekten zu beantragten Änderungen an Baudenkmälern und Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen bzw. Stellungnahmen zu Bauanträgen /ggf. mit denkmalpflegerischen Auflagen)
- Stellungnahmen zu städtebaulichen Planungen
- Vergabe von städtischen Denkmalpflegezuschüssen, Mitwirkung bei der Beschaffung von Denkmalzuschüssen Dritter an die Stadt und an sonstige Denkmaleigentümer
- Prüfung und Bescheinigung von steuerbegünstigten Denkmalpflegekosten
- Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Auftritt)
Welche Pflichten ergeben sich für den Eigentümer aus dem Denkmalschutz?
Denkmalschutz ist eine Konkretisierung der Sozialpflicht des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG). Die Eintragung in die Denkmalliste ist keine Enteignung. Die wesentlichen Pflichten für den Eigentümer sind:
die Erhaltungspflicht (§ 7)
Baudenkmäler sind instand zu halten, instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit dies zumutbar ist. Die Zumutbarkeit hängt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung von Zuschüssen und Steuervorteilen ab.
die Nutzungspflicht (§ 8)
Baudenkmäler sind zu nutzen, dass die Erhaltung der Substanz auf Dauer gewährleistet ist.
die Erlaubnispflicht (§ 9)
Beseitigung, Veränderung, Nutzungsänderung sowie Eingriffe in die engere Umgebung von Denkmälern bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde.
die Pflicht zur Anzeige bei Veräußerung (§ 10)
Der frühere und der neue Eigentümer müssen der Unteren Denkmalbehörde den Eigentumswechsel anzeigen.
die Pflicht zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes (§ 27)
Wer ein Denkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder zerstört, ist auf Verlangen der Unteren Denkmalbehörde verpflichtet, das Zerstörte wiederherzustellen.
Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetz können mit Geldbußen geahndet werden (§ 41 Bußgeldvorschrift).
Welche steuerlichen Vorteile ergeben sich aus der Unterschutzstellung?
Der Denkmaleigentümer kann mit indirekter Förderung durch die erhöhte Abschreibung für Herstellungs- bzw. Erhaltungsaufwand rechnen.
- Herstellungskosten beim nicht selbst genutzten Objekt:
Die begünstigte Abschreibung beträgt in den ersten acht Jahren 9 %, danach vier Jahre lang 7 % (§ 7 i Einkommensteuergesetz). - Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand
Normalerweise kann Erhaltungsaufwand nur im Jahr der tatsächlichen Zahlung geltend gemacht werden. Bei Baudenkmälern dagegen kann der Erhaltungsaufwand auf 2–5 Jahre verteilt werden (§ 11 Einkommensteuergesetz). - Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand beim selbst genutzten Objekt
Die Aufwendungen können wie Sonderausgaben abgezogen werden. Die begünstigte Abschreibung beträgt 9 % für 10 Jahre (§ 10 f Einkommensteuergesetz).
Weitere steuerliche Vorteile gibt es bei Spenden, bei der Einheitsbewertung und der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Welche Möglichkeiten der direkten Denkmalförderung gibt es?
- Einzelzuschüsse des Landes für größere denkmalpflegerische Maßnahmen, wenn die Kosten das für den Eigentümer zumutbare Maß überschreiten (z. B. bei umfangreichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung). Voraussetzung ist, dass sich auch die Stadt Neuss an dem Zuschuss beteiligt.
Der Antrag an die Bezirksregierung ist über die Untere Denkmalbehörde zu stellen. - Pauschalmittel zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater. (z. B. Fassadenanstrich, Fenstererneuerung etc.)
Das Land stellt der Gemeinde Mittel als jährliche Pauschale zur Verfügung. Diese müssen von der Gemeinde in gleicher Höhe aufgestockt werden.
Der Antrag ist an die Untere Denkmalbehörde zu richten. Für die Vergabe hat der Rat der Stadt Neuss 1985 Richtlinien erlassen. Bezuschusst werden Maßnahmen, die der Substanzerhaltung und gleichzeitig der Verbesserung des Stadtbildes dienen. Die Zuschusshöhe beträgt max. 10.000,– Euro pro Objekt und Jahr. - Denkmalförderprogramm des Landschaftsverbandes
- Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Wenn alle anderen Zuwendungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und wenn der Eigentümer nicht in der Lage ist, seinen Eigenanteil zu tragen, kann er Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beantragen.
Neben der spezifischen Denkmalförderung kommen ggfls. Förderprogramme mit anderer Zielrichtung in Frage (z.B. Städtebauförderung / Wohnungsbauförderung). Das muss man im Einzelfall prüfen.
Neusser Baudenkmäler
Beispiele

Die Christuskirche an der Breite Straße, 1906 von Moritz Korn entworfen, Zeugnis der Kirchengeschichte und der Stadtbaugeschichte, erhaltenwert aus künstlerischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen.

Die Kirche St. Paulus in Weckhoven, 1969 nach Entwurf von Fritz Schaller errichtet, Zeugnis der Kirchenbaugeschichte der 1960er Jahre, eine Faltwerkkonstruktion aus Stahlbeton, erhaltenswert vor allem aus architekturgeschichtlichen Gründen.

Bürgerhaus Münsterstraße 16, 1806 errichtet auf dem Gelände des 1804 abgerissenen Quirinusstiftes. Bauherr war der Notar Everhard Dünbier. Wichtiges Zeugnis der Stadtbaugeschichte. Erhaltenswert aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen.

Der Böxhof in Grefrath, eine stattliche Anlage aus dem 18./19.Jh.. Hier die große Barockscheune aus Fachwerk. Die Hofanlage ist ein Beispiel für den Bautypus des freigelegenen landwirtschaftlichen Großbetriebs vor 1900. Erhaltenswert aus volkskundlichen und städtebaulichen Gründen.
Eine ehemalige Maschinenhalle an der Breite Str./ Büttger Str., eine stützenfreie Halle mit Stahlbindern. Eines der letzten erhaltenen Beispiele für die gründerzeittypische Einlagerung von kleinen Gewerbebetrieben in innerstädtische Wohnquartiere.
Erhaltenswert aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen.

Bogenbrücke Nixhütter Weg, Backstein, 18.Jh., als Beispiel technischer Baukunst erhaltenswert aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen.

Der Wasserturm an der Mühlenstraße (ehemals Windmühlenturm). Mittelalterlicher Rundturm aus der Stadtmauer. 1881 aufgestockt als Wasserturm für das erste Neusser Wasserwerk an der Weingartstraße.

Das Wasserwerk an der Weingartstraße, 1881 errichtet. Beide Bauten sind wichtige Zeugnisse der Stadtentwicklung, erhaltenswert aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen.

Schleuse in der Obererft im Selikumer Park, 1809 im Zuge des Nordkanals errichtet, teilt das Wasser. Ein Teil fließt weiter in der Obererft, der andere Teil wird durch den Erftumfluter Reuschenberg wieder der Erft zugeleitet. Die Obererft speist den Nordkanal. Der Bau des Nordkanals ging zurück auf eine Anregung der Neusser Wirtschaft, die Handel und Verkehr fördern wollte.
1806 ordnete Napoleon den Bau des Kanals an, der zugleich als handelspolitische Maßnahme gegen Holland gedacht war. Als Holland dem Französischen Reich einverleibt war, wurden die Arbeiten eingestellt.
Das Bauwerk ist ein bedeutendes Zeugnis der Ingenieurbaukunst der napoleonischen Zeit. Erhaltenswert aus wissenschaftlichen und künstlerischen Gründen.

Der Hauptfriedhof an der Rheydter Straße, alter Teil, 1873 fertiggestellt. Für die Entstehungszeit typisch ist die gerasterte Wegeführung. Bedeutend für die Geschichte des Begräbniswesens, erhaltenswert aus wissenschaftlichen Gründen. Hier ein Blick durch eine der Wegeachsen auf die Friedhofskapelle.
Gruft Kraus auf dem alten Friedhof, 1926 errichtet, künstlerische Gestaltung von dem schweizer Bildhauer Johann Bossard. Expressionistische Bronze-Pieta auf steinernem Sarkophag, Gruftzugang mit Eisendeckel verschlossen.
Ein bedeutendes Zeugnis für die expressionistische Stilrichtung bei der Gestaltung von Grabmalen. Erhaltenswert vor allem aus wissenschaftlichen und künstlerischen Gründen.

Wegekreuz am Kuckhof, Horremer Straße, 18.Jh.. Ein Zeugnis der Volksfrömmigkeit. Erhaltenswert aus volkskundlichen und religionsgeschichtlichen Gründen.

Ehem. Rathaus Holzheim, 1912, Architekt Hubert Lichius, Kreisbaumeister des damaligen Kreises Neuss. Zeugnis der Ortsgeschichte. Erhaltenswert aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen.

Aalschokker im Sporthafen Grimlinghausen, 1937 in Holland gebaut aus genieteten Stahlplatten, Beispiel für die Aalfischerei auf dem Rhein in der 1. Hälfte des 20.Jh.. Erhaltenswert aus volkskundlichen, ortsgeschichtlichen, technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Gründen.

Bahnhof Norf, aus den 1880er Jahren, Anbauten 1910, errichtet als Typengebäude, Zeugnis der Eisenbahnbaugeschichte, erhaltenswert aus verkehrswissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen.

Schwann-Denkmal vor der ehemaligen Hauptpost, 1909 geschaffen von Josef Hammerschmidt, Bronze und Granit. Theoder Schwann, in Neuss geboren, Erfinder der Zellenlehre und Professor in Löwen.
Das Denkmal erinnert an einem bedeutenden Wissenschaftler. Es ist erhaltenswert aus künstlerischen und städtebaulichen Gründen.

Museum Haus Rottels, 1830 von Stephan Hermkes entworfen als Doppelhaus für die Gebrüder Rottels. Wichtiges Zeugnis der Stadtbaugeschichte. Erhaltenswert aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen.

Tankstelle an der Volmerswerther Straße, 1948 von der Deutsch-amerikanischen-Petroleum-Gesellschaft errichtet. Architekt Philip Schmitz. Die Tankstelle repräsentiert einen frühen Tankstellentyp der Nachkriegszeit, erhaltenswert vor allem aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen.